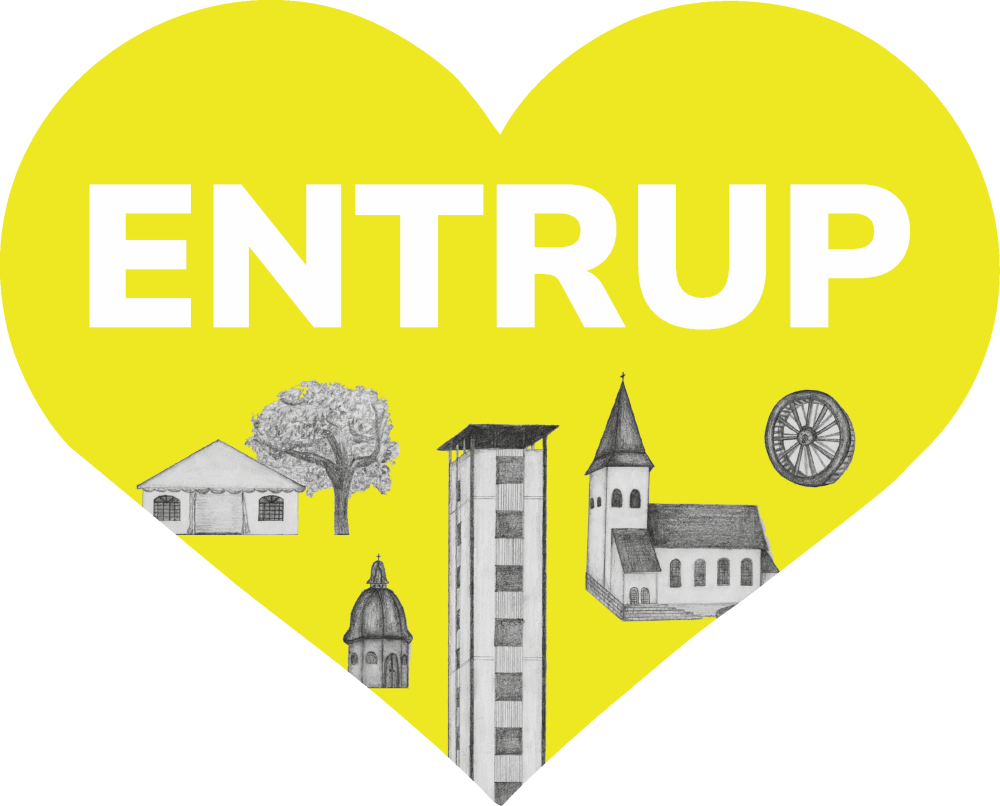Besuchern des Dorfes Entrup sticht das markante Gebäude auf dem Filleberg sogleich ins Auge, und vielen Bewohnern der kleinen Gemeinde gilt es schlechthin als Wahrzeichen. Leider wird über die Geschichte des einstmals als Kriegerkapelle bezeichneten Gefallenenehrenmals in den örtlichen Annalen nur wenig berichtet, obwohl gerade ein solches Mahnmal besondere Beachtung verdiente. Dem Anschein nach bedurfte es einer langen Planungsphase, bis die Kriegerkapelle 1929 schließlich errichtet wurde. Denn die kleine, nur wenig betuchte Gemeinde war erst drei Jahre zuvor mit dem Bau einer neuen Schule belastet worden. Große Sorgen bereitete den damaligen Gemeindevertretern zudem die Wasserversorgung: Es gab nur vier öffentliche Zieh- oder Schöpfbrunnen, und die Bevölkerung war weitestgehend auf das Wasser der Beber und des Klosterbachs angewiesen. Im April 1925 befasste sich der Gemeinderat, zum zweiten Mal nach 1919, mit dem Bau einer zentralen Wasserversorgung und beschloss deren Realisierung. Zur Ausführung gelangte der Plan jedoch nicht, weil die Bürger ihre Ersparnisse durch die Inflation verloren hatten und sie sich, nachdem sie zu einem Drrittel die Kosten für den Schulbau tragen mussten, keine weiteren finanziellen Lasten aufbürden wollten. Der Gemeinderat indessen mochte die Verantwortung für einen möglichen Brandfall nicht übernehmen und veranlasste 1926 ein Referendum. Doch selbst das Drängen des Dorflehrers, der für sieben Personen das Wasser aus einem Brunnen heranschaffen musste — so die mündliche Überlieferung —, führte zu keinem anderen Ergebnis. Per Bürgerentscheid wurde der Bau der Wasserleitung gestoppt. Umso mehr erstaunt es, dass der Amtmann zu Nieheim in einem am 22, Mai 1926 ausgestellten Bauschein einem Antrag zur Errichtung einer Krieger-Gedächtniskapelle die Bauerlaubnis erteilte. Ob der Gemeinderat nun einen schon für die Wasserleitung angesparten Betrag aus einer gewissen Trotzreaktion für den Bau eines Kriegerehrenmals zur Verfügung stellte oder ob er damit einem in der Bevölkerung gewachsenen echten Anliegen entsprach, lässt sich nicht mehr eruieren. Fest steht lediglich, dass der aus Entrup stammende Paderborner Architekt Johannes Antpöhler im Auftrag der Gemeindevertreter Pläne für den Bau eines offen gestalteten, einem Musikpavillon ähnelnden Ehrenmals entwickelte. Der mündlichen Überlieferung zufolge waren die ersten Spatenstiche schon ausgeführt, als Anton Reineke, der Vater des späteren Bürgermeisters und Ortsheimatpflegers Paul Reineke, mit einer Fotografie an der Baustelle erschien und die Frage aufwarf, ob die darauf zu sehende, vermutlich in der Schweiz abgelichtete Kapelle sich nicht besser als Kriegerkapelle eignen könnte. Die Gemeindevertreter müssen von dem Foto so beeindruckt gewesen sein, dass sie in einer Ad-hoc- Entscheidung die vorliegenden Pläne verwarfen und der oktogonalen Form mit dem barock-geschwungenen Dach den Vorzug gaben. Diese Überlieferung wird insofern gestützt, als im Baubuch des Amtes Nieheim- Steinheim am 26. April 1929 der Eingang eines Antrags zur Errichtung einer Krieger-Gedächtniskapelle vermerkt ist. Der Eintrag für die Ausstellung des Bauscheines datiert vom 27. Juni 1929. Die für den Bau notwendigen Steine, so wird berichtet, konnte der damals knapp 70-jährige August Schäfers (Haus Nr. 25 — jetzt Schillern 6) kostenlos im Vinsebecker Steinbruch brechen. Schäfers stammte aus Qeynhausen und nutzte vermutlich Verbindungen über einen in Vinsebeck lebenden Bruder. Seine Arbeitskraft stellte Schäfers, dessen Sohn August 1918 in englischer Gefangenschaft gestorben war, ebenfalls kostenlos zur Verfügung. Den Auftrag für die Dacheindeckung erhielt der Entruper Dachdeckermeister Josef Müller. Wegen der erforderlichen speziellen Fachkenntnisse in der Schieferverarbeitung wurde von ihm der Auftrag jedoch an das Nieheimer Dachdeckerunternehmen mit ebenfalls Namen Müller weitergereicht. An die Namen’der Gefallenen erinnerten schwarze Steintafeln mit goldener Schrift. Ein Zeitzeuge erinnert sich daran, dass von den Angehörigen der gefallenen Soldaten des 1. Weltkriegs ein Betrag von jeweils 20,00 Mark zu zahlen war. Das entsprach in etwa dem Monatslohn eines Arbeiters. In der Mitte des massigen Steinaltars befinden sich in eine Metallplatte eingelassene Reliquien. Sie wurden eingefügt, weil hier an Feiertagen wie Schützenfest die heilige Messe gefeiert wird. Der Versicherungsmakler Franz Müller, ein in Schwerte lebender Bruder der Gastwirtin Maria Grote (Bunten), der sich wiederholt großzügig gegenüber der Gemeinde Entrup zeigte, stiftete die Glocke für das Ehrenmal. Einiges gibt es über das eindrucksvolle, etwa zwei Quadratmeter große Bild über dem Altar zu berichten: Gemalt wurde es 1931 vom 1877 in Werne an der Lippe geborenen Kirchenmaler Heinrich Repke. Repke lebte und wirkte vorwiegend im Raum Wiedenbrück- Gütersloh-Paderborn. Bedeutende Werke von' ihm finden sich aber auch in den Niederlanden und in Übersee. Aus seiner Malschule gingen bekannte Maler und Kunstprofessoren hervor. Repkes Sohn Willi gilt in Fachkreisen ebenfalls als anerkannter Kunstmaler. Das Bild im Entruper Gefallenenehrenmal zeigt eine Szene aus dem Kreuzweg Jesu und beeindruckt zutiefst mit seiner ergreifenden Darstellung menschlichen Leidens. Detailliert ist von Repke die schmerzliche Physiognomie des gequälten Christus erfasst; zeugt der geöffnete Mund von Durst, Verzweiflung und vom Ende jeg!icher Kraft. Die feingliedrigen Hände des Kreuzträgers lassen diesen als einen äußerst sensiblen Menschen erscheinen, die warte 122, 2004 dem jegliche Gewalt fremd sein muss. Während sich in den Gesichtern der Jesus beweinenden Personen unendliche Trauer und Entsetzen lebendig widerspiegeln, weckt das dunkle, tumb-derbe Gesicht des Schergen ein beklemmendes Gefühl von Ohnmacht gegenüber jeglicher Gewalt. Transportiert wurde das Bild per Eisenbahn bis nach Bergheim, von wo es der Spediteur Johannes Beineke (Brix) mit seinem Einspänner (Fuhrwerk mit einem Pferd) abholte. Überliefert ist, dass Beineke, der auf seinem Kutschbock gern Sakramentslieder sang, nicht bemerkte, wie das Bild auf der unebenen Kalkstraße auf der Ladefläche immer weiter nach hinten gerüttelt wurde und schließlich auf die Straße fiel. Aufs höchste erschrocken kommentierte Beineke das Missgeschick mit dem Ausruf „Oh Luhe, niu häwwe ick iusen Hierchott int Kruize schmieten!“ („Oh Leute, jetzt habe ich unseren Herrgott auf den Rücken geworfen!“) Die Pflege des Ehrenmals wurde anfänglich von den Ehefrauen der jeweiligen Bürgermeister bzw. Bezirksverwaltungsstellenleiter übernommen. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs trafen Geschosse amerikanischer Streitkräfte die Kriegerkapelle, durchschlugen das Mauerwerk und zerstörten die Schrifttafeln. Nach der Beseitigung der Schäden wurden neue Sandsteintafeln mit den Namen der gefallenen und vermissten Soldaten beider Weltkriege angebracht. Um die Finanzierung bemühte sich der Heimatschützenverein, der das benötigte Geld in einer Listensammlung zusammentrug. Dem Vorschlag eines Schützen folgend, wurden von den ohnehin schon leidenden Angehörigen der Gefallenen und Vermissten keine Sonderopfer mehr verlangt. Im Ersten Weltkrieg hatte Entrup 18 Gefallene zu beklagen; im Zweiten Weltkrieg kehrten 36 Männer nicht zurück. Allein im letzten Weltkrieg verlor die kleine Gemeinde damit 20 Prozent der männlichen Bevölkerung. An den Innenwänden des Ehrenmals wurde für jedes Kriegsopfer ein schmiedeeiserner Kerzenhalter angebracht. Mitte der 1980er Jahre waren die Sandsteintafeln vermutlich vom Ruß der Kerzen und von aufsteigender Feuchtigkeit so stark. verschmutzt, dass die Namen nur noch schlecht lesbar waren. Ein Reinigungsversuch mit Säure schlug jedoch fehl und zerstörte die Tafeln weitgehend. Wieder unter Federführung des Heimatschützenvereins wurden neue Tafeln aus Anröchter Dolomit angeschafft. Um einer erneuten Verschmutzung durch aggressive Kerzenrauche vorzubeugen, ließ die Gemeinde die Kerzenleuchter von den Wänden abmontieren. Am 11. April 1985, so ist dokumentiert, ging beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe ein Antrag ein, in dem die Gemeinde Entrup um einen Zuschuss für die Erneuerung der Schiefereindeckung bat. Der Landschaftsverband bewilligte damals 2600 DM. In Eigenleistung wurden zur gleichen Zeit die Holztür erneuert und die beiden Stufen im Eingangsbereich um ein Podest erweitert. Als 1998 erneut deutlich wurde, dass aufsteigende Nässe das Bauwerk schädigte und eine grundlegende Sanierung der Fundamente erforderlich wurde, entbrannte erneut eine Diskussion darüber, wer die Kosten für den Erhalt des Ehrenmals zu tragen hat. Während sich die Stadt Nieheim als Rechtsnachfolger der ehemals selbstständigen Gemeinde Entrup von allen Verpflichtungen distanzierte und den Heimatschützenverein in der Pflicht sah, lehnte dieser die Übernahme der Kosten mit der Begründung ab, die Kriegerkapelle sei von der politischen Gemeinde erbaut. Es sei somit die Aufgabe der Stadt Nieheim, das mittlerweile unter Denkmalschutz stehende Gebäude zu unterhalten. Um größeren Schäden vorzubeugen, erklärte sich der 1993 gegründete Heimatverein „Entrup aktiv“ bereit, die Sanierung voranzutreiben. 1999 wurden die Bruchsteinfundamente freigelegt und mit einem Betonkranz bewehrt. Gleichzeitig wurde das Mauerwerk mittels einer Ringdrainage trockengelegt. Um das vom Dach abfließende Regenwasser vom Bruchsteinmauerwerk fernzuhalten, wurde eine Regenrinne installiert. Außerdem erhielt der Innenraum über Luftschlitze in der Eingangstür und im Deckenbereich eine Dauerbelüftung. Als sich bei der Renovierung des Innenraumes herausstellte, dass sich im Verlauf der Zeit hinter dem Altarbild eine zentimeterdicke, aggressive Schicht aus Ruß und Spinnwebe gebildet hatte, wurde diese entfernt und die Oberfläche mit einem Schutzwachs versiegelt. Die Arbeiten erfolgten in Eigenleistung, die Kosten für das benötigte Material bewilligte der Ortsausschuss aus Mitteln für kleine Dorferneuerungsmaßnahmen. Um den Schlagregen von Westen abzuhalten, erfolgte hinter dem Ehrenmal eine Eibenbepflanzung. Die Bäume wurden jedoch zum größten Teil trocken und teilweise zerstört. Den Innenraum des Gefallenenehrenmals schmückt heute ein dichtes, einer Dornenkrone ähnelndes Geflecht, aus dessen Mitte als Zeichen neuen Lebens eine Rose herausragt. Des Weiteren befindet sich in ihm ein schlichter Kerzenständer aus starken, zusammengeschweißten Kettengliedern. Er symbolisiert eine als Fessel unbrauchbar gewordene Kette, die nun als Lichtträger dient. Lang anhaltende Diskussionen folgten dem vom damaligen Ortsheimatpfleger Heinrich Kros geäußerten Wunsch, die Tafeln mit den Namen der Gefallenen lesbarer zu machen. Bedingt durch den grauen Stein, die relativ kleine, kantige Schrift und den begrenzten Lichteinfall, war die Schrift nur noch aus nächster Nähe zu entziffern. Nachdem das Amt für Denkmalpflege in Münster, ein Steinmetz und weitere Fachleute konsultiert worden waren, erhielt der Malermeister Werner Rieks aus Nieheim den Auftrag, die Tafeln auszumalen. Nach einem ersten Versuch, die konkaven Flächen des stark absorbierenden Materials aufzuhellen, entschloss sich der Fachmann jedoch, die erhabenen Buchstaben mit einer dunklen Lasur zu überziehen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass dieses die richtige Entscheidung war. Bei den jährlichen Schützenfesten 7, Wird beim Ehrenmal am Samstagabend der Große Zapfenstreich gespielt und vom Schützenverein ein Kranz niedergelegt. Sonntags ist hier die letzte Station der Johannesprozession. Am Schützenfestmontag wird morgens eine Schützenmesse unter freiem Himmel gefeiert. Auch an Allerheiligen geht die Bevölkerung vor dem Gräbergang in einer stillen Prozession zum Ehrenmal und gedenkt der Kriegstoten. Am 17. Juli 2004 wird die Gemeinde Entrup mit einem kleinen Festakt an den Bau des Gefallenenehrenmals vor 75 Jahren erinnern.
Gefallenenehrenmal - 75 jähriges Jubiläum
- Details
- Kategorie: Allgemeines
Von Josef Köhne
veröffentlicht in "die Warte 122" aus dem Jahr 2004